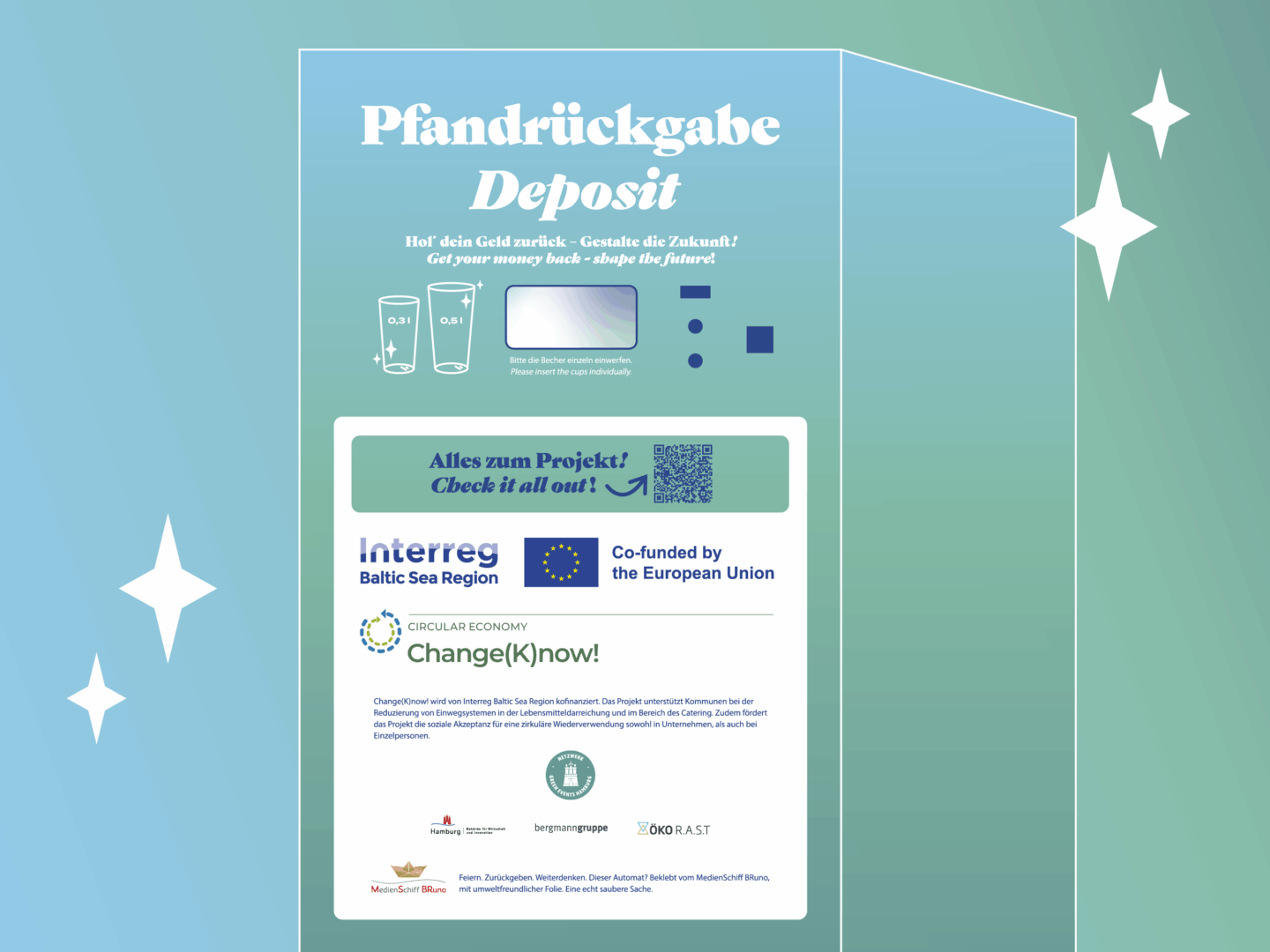Seit dem Pariser Klimaabkommen 2015 ist klar: Die Welt muss bis 2050 CO₂-neutral und bis 2070 vollständig klimaneutral werden. Auch Deutschland hat nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts seine Ziele verschärft – bis 2045 soll Klimaneutralität erreicht werden. Parallel dazu wächst die Bereitschaft von Unternehmen, Verbänden und Einzelpersonen, freiwillig zum Klimaschutz beizutragen. Doch wie lässt sich Verantwortung glaubwürdig und wirksam übernehmen?
Emissionsausgleich – gute Idee, oft mangelhafte Umsetzung
Viele greifen auf das Konzept der Kompensation zurück: Unvermeidbare Emissionen werden durch Projekte außerhalb des eigenen Wirkungsbereichs ausgeglichen – etwa durch Aufforstung oder Investitionen in saubere Technologien. Das klingt zunächst plausibel, birgt jedoch erhebliche Probleme. Über zwanzig Jahre Erfahrung mit dem Clean Development Mechanism (CDM) der UN zeigen: Oft fehlt die sogenannte Zusätzlichkeit – die Maßnahme wäre ohnehin erfolgt. Weitere Risiken sind etwa fehlende Dauerhaftigkeit von Senken (z. B. durch Waldbrände), problematische Baseline-Annahmen, perverse Anreize oder Doppelzählungen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich Emissionen vermieden bzw. dauerhaft gebunden wurden, ist häufig nicht hoch genug, um eine verlässliche Kompensation zu gewährleisten. Trotzdem werben viele Organisationen weiterhin mit Labels wie „klimaneutral“, obwohl sie de facto weiterhin Emissionen verursachen. Besonders problematisch ist dies angesichts der Produktionsvorketten, bei denen oft erhebliche Mengen an Treibhausgasen entstehen. Die Realität ist: Heute klimaneutral zu sein, ist faktisch unmöglich. Solche Aussagen erzeugen ein Risiko des Greenwashings – also der bewussten Täuschung über den tatsächlichen Klimabeitrag.
Die Verantwortung selbst in die Hand nehmen
Vor diesem Hintergrund plädiert das Öko-Institut mit dem Konzept der Klimaverantwortung für einen realistischeren und verantwortungsvolleren Umgang mit Emissionen. Der zentrale Unterschied: Statt einen angeblichen Ausgleich zu behaupten, steht die gezielte Emissionsminderung im Vordergrund. Unvermeidbare Emissionen werden zwar weiterhin berücksichtigt, aber nicht durch fragwürdige Zertifikate „neutralisiert“, sondern durch ein Budget bepreist, das gezielt in Klimaschutzmaßnahmen investiert wird.
Dieses Budget basiert auf einem anlegbaren Preis pro Tonne CO₂, der sich etwa an den gesellschaftlichen Schadenskosten orientiert. Laut Umweltbundesamt liegen diese aktuell bei rund 300 €/t und steigen bis 2050 auf über 430 €/t. Zum Vergleich: Der europäische Emissionshandel bewegt sich derzeit um 70 €/t, der Durchschnittspreis für globale Kompensationszertifikate liegt bei lediglich 2 bis 6 €/t. Anbieter wie atmosfair oder Myclimate legen freiwillig höhere Preise (ca. 30 €/t) zugrunde, doch auch diese liegen weit unterhalb der relevanten Referenzwerte. Diese Differenz zeigt: Wer mit „Billigzertifikaten“ ausgleicht, übernimmt keine echte Verantwortung.
Wie andere es machen
Stattdessen zeigen Beispiele wie der Deutsche Alpenverein (DAV) oder die UEFA Euro 2024, wie Klimaverantwortung in der Praxis aussehen kann. Der DAV legt intern verbindliche CO₂-Preise fest (z. B. 90 €/t bis 2024, 140 €/t ab 2025), um damit Emissionen im eigenen Verantwortungsbereich zu reduzieren und zusätzlich hochwertige Minderungsprojekte zu finanzieren.
Achtung! Die Identifizierung hochwertiger Minderungsprojekte ist nicht ganz trivial. Die folgenden Tools können dabei unterstützen, bedürfen aber einer gewissen Einarbeitung: · Öko-Institut, EDF & WWF: The Carbon Credit Quality Initiative - CCQI · GHGMI & SEI: Carbon Offset Guide - COG
Die UEFA wiederum verzichtete bewusst auf das Label „klimaneutral“ und richtete stattdessen einen Klimafonds ein, aus dem über 80 Projekte unterstützt wurden – finanziert mit einem Preis von 25 €/t. Dieser Preis lag zwar unterhalb des von Fachleuten empfohlenen Niveaus, doch der Schritt in Richtung Transparenz war entscheidend.In die ungewisse Zukunft investieren
Ein weiteres Element der Klimaverantwortung ist die Investition in transformative Technologien, die heute noch geringe, aber zukünftig große Minderungsbeiträge leisten können – etwa synthetische Kraftstoffe für Luft- und Schifffahrt. Auch wenn sie aktuell teuer sind und nicht sofort zur Emissionsminderung beitragen, sind sie essenziell für eine klimaneutrale Zukunft. Klimaverantwortung schafft hier Spielraum für gezielte Innovationsförderung – ein Aspekt, der in klassischen Kompensationsstrategien kaum vorkommt.
Zusammengefasst: Was bedeutet Klimaverantwortung?
Das Konzept unterscheidet sich somit in zentralen Punkten von klassischer Kompensation:
- Kein Anspruch auf Ausgleich, sondern bewusster Beitrag zur Erreichung langfristiger Klimaziele,
- Vermeidung vor Reduktion vor Verantwortung für verbleibende Emissionen,
- Transparenz über verbleibende Emissionen und deren Bewertung,
- Budgetbildung auf Basis angemessener CO₂-Preise,
- Nutzung des Budgets für externe Projekte mit hoher Qualität und ggf. auch interne Minderung,
- Einbindung transformatorischer Ansätze, auch wenn deren Effizienz aktuell noch gering ist.
Diese Umorientierung von der Illusion der Klimaneutralität hin zu einer ehrlichen Klimaverantwortung verändert auch die Kommunikationsstrategie. Sie lädt Organisationen ein, sich nicht länger hinter fragwürdigen Zertifikaten zu verstecken, sondern ihre Anstrengungen offen zu zeigen – mit allen Herausforderungen, aber auch mit wachsendem Vertrauen bei Öffentlichkeit und Stakeholdern.
Im Fazit wird deutlich: Klimaverantwortung bedeutet, ein fundiertes Klimaschutzkonzept mit dem Ziel absolut null Emissionen zu erarbeiten, umzusetzen und laufend zu überprüfen. Es geht nicht um Ausgleich, sondern um konkrete Minderungsbeiträge zur Zielerreichung. Die dafür eingesetzten Budgets basieren auf CO2-Preisen mit denen Klimaneutralität erreicht werden kann, statt am Preis für die günstigsten Ausgleichszertifikate. Die auf diese Art erzielte Finanzierung von Minderungsmaßnahmen stärkt nicht nur den Klimaschutz, sondern auch das Bewusstsein der beteiligten Menschen. Letztlich gilt: Klimaschutz ist kein „Lieferservice“. Er erfordert das Mitwirken aller – Mitarbeitende, Kund:innen, Mitglieder, Teilnehmende. Klimaverantwortung schafft hierfür einen ehrlichen und tragfähigen Rahmen.